 4000 Mark für zwei Wochen: Leicht verdientes Geld und ein
netter Spaß noch dazu. Denken die 20 Freiwilligen, die sich auf das Experiment einlassen.
Um die Erforschung des Aggressionsverhalten in einer künstlichen Gefängnissituation s&l
es gehen. Und zunächst halten die Beteiligten das Ganze für ein Spiel. Das denkt lange Zeit
auch der frühere Journalist und jetzige Taxifahrer Tarek Fahd, der hinter der Anzeige eine
Zeitungsstory wittert und sich, ausgerüstet mit einer Geheimkamera, als Undercover-Journalist
in das Experiment einschmuggelt. Ebenso agiert Steinhoff undercover, da er zu dem Experiment
von der Bundeswehr abkommandiert und eingeschleust wurde. Kurz vorher hat Tarek bei einem
Autounfall die schöne, kühle Dora kennen gelernt, die ihm nun in den langen Nächten in der Zelle
nicht mehr aus dem Kopf gehen wird. Nach Tests und Vorbereitungen beginnen die 20 männlichen
Versuchspersonen ihren ersten Gefängnistag in einem eigens dafür eingerichteten, mit Video-
Überwachungskameras ausgestatteten Zellentrakt im Keller der Universität. Dort werden die
Testpersonen per Zufallsgenerator in „Strafvollzugsbeamte" und „Gefangene" eingeteilt.
Unter Beihilfe einiger Studenten überwachen der Leiter des Experiments, Professor Thon und seine
Assistentin Dr. Juna Grimm den Verlauf des Versuchs rund um die Uhr auf Monitoren.
4000 Mark für zwei Wochen: Leicht verdientes Geld und ein
netter Spaß noch dazu. Denken die 20 Freiwilligen, die sich auf das Experiment einlassen.
Um die Erforschung des Aggressionsverhalten in einer künstlichen Gefängnissituation s&l
es gehen. Und zunächst halten die Beteiligten das Ganze für ein Spiel. Das denkt lange Zeit
auch der frühere Journalist und jetzige Taxifahrer Tarek Fahd, der hinter der Anzeige eine
Zeitungsstory wittert und sich, ausgerüstet mit einer Geheimkamera, als Undercover-Journalist
in das Experiment einschmuggelt. Ebenso agiert Steinhoff undercover, da er zu dem Experiment
von der Bundeswehr abkommandiert und eingeschleust wurde. Kurz vorher hat Tarek bei einem
Autounfall die schöne, kühle Dora kennen gelernt, die ihm nun in den langen Nächten in der Zelle
nicht mehr aus dem Kopf gehen wird. Nach Tests und Vorbereitungen beginnen die 20 männlichen
Versuchspersonen ihren ersten Gefängnistag in einem eigens dafür eingerichteten, mit Video-
Überwachungskameras ausgestatteten Zellentrakt im Keller der Universität. Dort werden die
Testpersonen per Zufallsgenerator in „Strafvollzugsbeamte" und „Gefangene" eingeteilt.
Unter Beihilfe einiger Studenten überwachen der Leiter des Experiments, Professor Thon und seine
Assistentin Dr. Juna Grimm den Verlauf des Versuchs rund um die Uhr auf Monitoren.Die Testpersonen beschnuppern einander, lernen sich kennen, schwanken zwischen nervöser Neugier und ausgelassenem Übermut und finden sich langsam in ihre Rollen ein: Die Wächter pochen auf ihre Autorität, die Gefangenen rebellieren gegen Demütigung und Schikane. Zu Anfang wurde für alle Teilnehmer eine Reihe Regeln aufgestellt, die sie zu befolgen haben:
1. Die Gefangenen reden sich gegenseitig mit Nummern an.
2. Alle Gefangenen reden alle Wärter mit „Herr Strafvollzugsbeamter" an.
3. Nach „Licht aus!" redet keiner der Gefangenen mehr.
4. Mahlzeiten sind vollständig aufzuessen.
5. Die Gefangenen beschädigen kein Anstaltseigentum.
6. Nichteinhaltung der Regeln wird bestraft.
Die „Strafvollzugsbeamten" müssen nur eine Regel befolgen: Es ist strengstens untersagt, in irgendeiner Weise Gewalt anzuwenden. So, wie Tarek wegen seiner provozierend-lockeren Art bald zu einer Art Anführer der „Häftlinge" wird und sich besonders des Kioskbesitzers Schütte annimmt, so profilieren sich unter den „Wärtern" der anfangs so zurückhaltende Beaus, der joviale Eckert und der korrekte Kamps. Niemand der Beteiligten ahnt, dass das Experiment zu einem erbitterten Kampf auf Leben und Tod eskaliert. Währenddessen versucht Dora draußen herauszufinden, wo Tarek geblieben ist...
„Das Experiment" trifft den Zuschauer mit voller Wucht und setzt Maßstäbe auch über den deutschen Film hinaus. Der schwindelerregend spannende Psychothriller fesselt durch ein unverbrauchtes, mit folgerichtiger Präzision entwickeltes Sujet, das wie selten in einem Film zuvor, die Triebfedern von Gewalt und Sozialpathologie offenlegt.
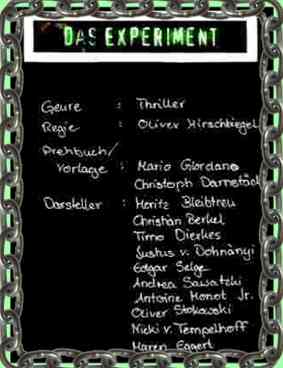 Mit Regisseur und Darstellern lässt sich der Zuschauer schon von Beginn an von dem Gedankenexperiment
insofern fesseln, als er erstens den schnell vollzogenen Schritt von Spiel zum bitteren Ernst ahnt und
zweitens, weil der Dialog des Films mit dem Publikum ein ganz besonderer ist: die beruhigende Sicherheit der
Fiktion fällt weg, der Zuschauer betrachtet die Entwicklungen auf selbstreferentieller Ebene und letztlich
geschieht das, was das heutige Kino nur noch selten leistet: der Film wird miterlebt, jeder schützende
Zwischenraum bricht ein, weil der Regisseur menschliche Abgründe in unerbittliche Konsequenzen seziert
und beängstigend vorführt, wie schnell Gewaltschwellen sinken und Menschen zu Bestien degenerieren können.
Natürlich ist eine gängige These, dass psychischer Druck, Schikane und Demütigung einen Menschen eher brechen
als psychische Gewalt, aber die Logik der sich zuspitzenden Gewaltspirale ist eben die, dass die große
Entladung schließlich in der Bereitschaft zur Vernichtung erfolgt - auf beiden Seiten. Die Klaustrophobie der
Randsituation wird durch Präzision von Kameraarbeit und effektvollen Lichteinsatz zusätzlich investiert.
Mit Regisseur und Darstellern lässt sich der Zuschauer schon von Beginn an von dem Gedankenexperiment
insofern fesseln, als er erstens den schnell vollzogenen Schritt von Spiel zum bitteren Ernst ahnt und
zweitens, weil der Dialog des Films mit dem Publikum ein ganz besonderer ist: die beruhigende Sicherheit der
Fiktion fällt weg, der Zuschauer betrachtet die Entwicklungen auf selbstreferentieller Ebene und letztlich
geschieht das, was das heutige Kino nur noch selten leistet: der Film wird miterlebt, jeder schützende
Zwischenraum bricht ein, weil der Regisseur menschliche Abgründe in unerbittliche Konsequenzen seziert
und beängstigend vorführt, wie schnell Gewaltschwellen sinken und Menschen zu Bestien degenerieren können.
Natürlich ist eine gängige These, dass psychischer Druck, Schikane und Demütigung einen Menschen eher brechen
als psychische Gewalt, aber die Logik der sich zuspitzenden Gewaltspirale ist eben die, dass die große
Entladung schließlich in der Bereitschaft zur Vernichtung erfolgt - auf beiden Seiten. Die Klaustrophobie der
Randsituation wird durch Präzision von Kameraarbeit und effektvollen Lichteinsatz zusätzlich investiert.Dem Regisseur Oliver Hirschbiegel müsste zur Last gelegt werden, dass er in seiner Radikalität das berühmt-berüchtigte Stanford-Experiment hinter sich lässt, es in seinem Entwurf, der der Ursache der Gewalt auf den Zahn fühlt, auf die nächste Stufe hebt und Zugeständnisse an Konventionen des Gewaltkinos macht. Zudem ist offensichtlich, dass der von Moritz Bleibtreu gespielte Reporter als dramaturgisches „Anheizelement" eingeschaltet wurde, um Machtkämpfe und Spannungskurve im Zeitraffer zuzuspitzen; doch Hirschbiegels wahnsinniges Kabinen der Grenzgänger scheint die Korrespondenz der beiden konkurrierenden Gruppen in Bedingung, Folgerichtigkeit und Dynamik mit annähernd psychoanalytischer Kompromisslosigkeit zu entwickeln. Die Glaubwürdigkeit des Zellenhorrors findet sich in der Abbildung von fortschreitender Apathie, Autoritätshörigkeit und Realitätsverlust auf der einen und sadistische Machtgelüste als Kompensation von Minderwertigkeitspsychen auf der anderen Seite. Schlichtweg grandios vermag es zum Beispiel Justus von Dohnànyi („Berus"), unter einer unscheinbaren Hülle sukzessiv den Sadisten hervorzukehren oder Timo Dierkes („Eckert"), hinter dem Elvis-Imitator einen potentiellen Vergewaltiger wachsen zu lassen.
Probanden zeigten sich tendenziell unterbelichtet; so darf man legitim fragen, ob eine höhere Intelligenz und damit ein reibungsloses Rollenspiel erbracht hätte. Weiterhin ist die parallel verfolgte Liebesgeschichte mit Sicherheit keine erzählerische Notwendigkeit, denn der Durchhaltewillen Tareks scheint sich schon durch sein Reporterethos zu bedingen.
Die Spannung spitzt sich bin ins Unerträgliche zu und gipfelt in der folterhaften Wirklichkeitswerdung der „Black Box". Panische, klaustrophobische Enge trifft auf ein Schlussbild von bedächtiger Weite, auch der Seele, aber nicht dann erst ist klar, dass Oliver Hirschbiegel mit einfachen Mitteln einen der extremsten und einschneidensten Psychothriller der letzten Jahre gemacht hat.
Wieso übernehmen Menschen nach kürzester Zeit neue Rollen, wachsen regelrecht in diese fiktive Identität hinein und zeigen in der Gruppendynamik bereits nach kürzester Zeit Bereitschaft zum Äußersten, was in jedem Falle derjenigen, die das Gewaltmonopol inne haben, den Verzicht auf einen lange erlernten Moralkodex und sadistische Machtlust bedeuten kann? Der erschütternde Ausgang des Experiments lieferte bedrückende Argumente für die These, das der Mensch, der sich als Subjekt in erster Linie von innen heraus zu erleben meint, in Drucksituationen seine Identität und Handlungsfreiheit, insofern noch gegeben, fast ausschließlich durch externe Konditionen bestimmt. Wie wir, standen die Probanden vor dem Experimentbeginn sicher im Gesellschaftsgefüge, waren nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und zeigten kein aggressives Potential. Was dann aber bereits nach den ersten Stunden durch die Eigendynamik des Rollen„spiels", in dem körperliche Gewalt zum sofortigen Abbruch führen sollt, losbrach, greift Oliver Hirschbiegel in seinem Kinofilmdebüt auf.
Die Verhaltensforschung bezeichnet jene Prozesse, deren Systeme nicht, oder nicht vollständig bekannt sind, als „Black Box". Die Metapher legt nahe: Die entschlüsselnde, Licht in das Dunkel der Box bringende Einsicht in das System ist nicht möglich, vielmehr nur eine deutende Beobachtung von „Input" und „Output", von wissenschaftlich provozierter Eingabe und empirischer Verwertung der Ausgabe. Das ist eine Rechnung mit unbekannten Variablen, bekannt eher aus dem Bereich der Biologie, die Anfang der 70er Jahre aber im berühmt-berüchtigten Stanford-Experiment von Philip Zimbardo auf die Sozialsphäre des Menschen praktisch angewandt wurde. Ziel des Universitätspsychologen war es, in einem Experiment Gehorsam und Aggressionspotential an vierundzwanzig freiwilligen Testpersonen zu erforschen - in einem „simulierten Gefängnis", vergleichbar einem „Big Brother Extrem", mit dem Unterschied, dass alles mit einem Spiel beginnt: Die männlichen Probanden, psychisch und physisch von normaler Verfassung, sollten zwei Wochen in dem mit Videokameras gespickten Scheinknast verbringen; die eine Hälfte als Häftlinge, die andere als Wärter. Ausgewählt wurde nach Zufallsprinzip.
Der Entstehungshintergrund war die Frage danach, unter elchen Bedingungen sich Menschen einer Gruppe unterwerfen, sich „deindividualisieren", Gewalt ausüben und welche Faktoren den Grad der psychischen und physischen Brutalität bestimmen. Wer beansprucht die Autorität, wie laufen Machtkämpfe, Solidarisierung und die Unterstützung der Schwächeren ab? Nichts neues brachte die Erkenntnis, dass sich soziale Bezugs- und Zeichensysteme durch Gruppenkonstellationen definieren, aber schon dadurch, dass sich die Versuchspersonen bereit erklären mussten, während des hermetisch abgeschlossenen Experiments auf bürgerliche Grundrechte zu verzichten, deutete sich die Radikalität des Versuchs an. Die Klasse des Films wird spätestens dann deutlich, wenn man ihn mit ähnlich entlarvenden Streifen aus Hollywood vergleicht: das Feingefühl Hirschbiegels bei der Charakterisierung seiner Häftlinge lässt Frank Darabonts „Green Mile" ziemlich alt aussehen, und die Hochspannung, geschürt durch die zunehmende klaustrophobische Enge, übertrifft an Intensität den „Cube" bei weitem, zumal dessen Figuren weniger klischeefrei waren. Aber die eigentliche Leistung des Experiments bleibt natürlich der Denkanstoß, dem man unweigerlich erliegt. Hätte ich in der Situation der Gefangenen, die ja eigentlich keine waren, genauso reagiert? Wäre es nicht problemlos gewesen, vierzehn Tage einfach gepflegte Langeweile zu verbreiten und, um die Motivation der Personen aufzugreifen, die 4000DM einzustecken? Und so fragt man sich während des Films die ganze Zeit, ob das Geschehen nicht fllmdienlich überdramatisiert wird und hofft beinahe, dass derartige Reaktionen in der Realität wohl kaum zustande kämen. Aber so sehr man gewillt ist, dem Film hier Vorwürfe zu machen, so deutlich muss man feststellen, dass die Handlungsweisen nur allzu glaubwürdig bleiben. Zumal das echte Experiment an der Stanford University eben auch nach sechs Tagen abgebrochen werden musste.
Informationen über Stanford unter www.prisonexp.org