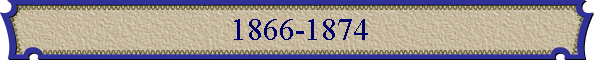
|
|
|
1866 - 1874 Der Alltag hat die politischen Sorgen sicher bald vergessen lassen. Das Leben geht auch damals seinen Gang, und der Feuerwehrkommandant und -vorstand, Johann Floritz, ruft sicher auch wieder seine Leute zur Übung zusammen, obwohl man sich bei all dem Gerät, das heute zur Verfügung steht, frägt, was es damals eigentlich zum Üben gegeben hat. Einfache Leitern zum Tragen gibt es, Löscheimer und Einreißhaken, Einreißhaken, die vier Männer mühsam handhaben müssen. Der gewichtigere Teil des Vereinslebens spielt sich aber ohne Frage im Wirtshaus ab. Es ist das Jahrhundert der Herrengesellschaften, Vereine und Stammtische. Wir können es aus dem Protokollbuch des Starnberger Vereins deutlich sehen und gehen nicht fehl, wenn wir annehmen, daß der Wallfahrtsort der Leutstettener Feuerwehrmänner seinerzeit das Gasthaus in Petersbrunn ist. "Montag 19ter März", also am Josephitag 1866, versammelt sich die Starnberger Feuerwehr in Schirmmützen, das ist eine Neuheit, und marschiert mit einer Münchener Musik nach Petersbrunn. Dabei beteiligt sich der Kommandant der Wolfratshausener Feuerwehr, und alle werden sie "vom Zweigverein Leitstetten in voller Rüstung empfangen". Dann liest man zum Beispiel seitenweise: "Samstag den 17ten Februar Kneipe. mit Ballotage." Ein neuer Feuerwehrmann ist aufgenommen worden; und die Ballotage ist die dazugehörige geheime Abstimmung, wobei man mit schwarzen und weißen Kugeln seine Ja- oder seine Nein-Stimme abgibt. Und weiter lesen wir: "Samstag 24ten Februar - Kneipe" -"Samstag den 3ten März - Kneipe" - "Samstag den loten März - Kneipe" - Samstag Kneipe - Samstag Kneipe - Samstag Kneipe - so geht das fort. Petersbrunn ist noch in der Spätbiedermeierzeit ein gar nicht unbekanntes Bad, aber das Kneipen der Feuerwehrleute hat deshalb noch lange nichts mit dem Heilbad Petersbrunn zu tun. Dieses Kneipen schreibt man mit einem p, denn von einem Pfarrer Sebastian Kneipp weiß man um diese Zeit in Leutstetten und Petersbrunn noch nichts. Mit "Kneipen" meint man bechern, trinken. Es ist ein Wort, das im studentischen Verbindungswesen heute noch bekannt ist. Vielleicht haben die Münchner Künstler diesen Begriff nach Petersbrunn getragen. Wir wissen jedenfalls, daß damals die gesamte Münchner Künstlerschaft ins Isartal, an den Starnberger See und eben auch nach Petersbrunn ihre berühmten Maiausflüge macht. Von so einem Ausflug erzählt uns eine köstliche Bleistiftzeichnung von Ludwig Skell. Unter mächtigen Buchen musizieren ein Geiger, ein Baßgeiger und ein Klarinettist, vorne links lagern Künstler um ein großes Faß, im Hintergrund sitzen sie an Tischen und Bänken, tanzen mit Frauen, Bräuten und Töchtern, und in einem kleinen Ausblick sehen wir im Hintergrund Schloß Berg und die Zugspitze. Hierher ist auch Moritz von Schwind gekommen. Wir wissen es deshalb so genau, weil das Wirtshausschild von Petersbrunn, das jetzt an der Wirtschaft von Leutstetten hängt, durch ihn in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Hier hat er es skizziert, um es in seinem berühmten Bild von der Hochzeitsreise zu verwenden. Das Kneipen der Feuerwehrmänner scheint damals schon sprichwörtlich gewesen zu sein, denn Fr. Jakob schreibt 1883 in seiner kleinen Schrift "Die freiwillige Feuerwehr ein Ehren-Stand", Untertitel "Einige Worte zur Aufmunterung insbesondere für Landfeuerwehren", erschienen in München: "Im Umgange mit den Kameraden ist es Pflicht des freiwilligen Feuerwehrmannes, freundlich, kameradschaftlich und gesellig zu sein, in der Gesellschaft munter und anständig, alle Hänselei und alles ,Aufzwicken' ist desselben unwürdig. Ein anständiges Lied, ehrbare Unterhaltung und eine gute Maß Bier zur rechten Zeit und am rechten Orte' sind ja Niemandem verwehrt. Nicht nur bei Bränden und Uebungen, und dem, was er da hört, seine ganze Aufmerksamkeit zu schenken, denn da soll er ja was lernen, um es dann praktisch anzuwenden. - Daß unterdessen etliche z. B. Karten spielen', während ein Vortrag gehalten wird, das kann doch nicht geduldet werden. Vorgekommen ist es aber." Hier spricht ein erfahrener, auch etwas verärgerter, engagierter Freund der Feuerwehr. Und wie recht er gehabt haben muß, kann man der Districts-Feuerlösch-Ordnung von 1879 entnehmen. "§ 46. Das Zechen in den Wirthshäusern eines Ortes, in welchem ein Brand ausgebrochen ist, ist verboten. Zuwiderhandelnde können auf Anordnung des Bürgermeisters aus den Wirthshausräumlichkeiten entfernt werden. Der Aufenthalt im Wirthshause auf kurze Zeit zur Erholung, Erwärmung oder Stärkung fällt nicht unter dieses Verbot." Das geht natürlich nicht nur die Feuerwehrleute an. Das 19. Jahrhundert war halt eine recht gesellige Zeit, in der sich das gesellschaftliche Leben weitgehend im Wirtshaus, gar am Stammtisch abgespielt hat. Das gesellschaftliche Leben der Mannsbilder wohlgemerkt, nicht das der Frauen. Nun hat die Feuerwehr sicher nicht nur den Durst gelöscht, sondern auch Brände, nur wissen wir darüber recht wenig. Einer aber ist uns aus dieser Zeit überliefert. Im Jahre 1868 brennt in Petersbrunn das Wirtschaftsgebände ab. Die Leutstettener Wehr steht mehr oder weniger macht- und wehrlos mit ledernen Löscheimern dem Brand gegenüber. Sie kann zwar nichts mehr retten, aber wenigstens das Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude verhindern. Die Feuerwehr Leutstetten ist gerade fünf Jahre alt, da schreckt das alte Europa ein neuer Krieg auf. Frankreich erklärt, nach kurzem diplomatischen Vorspiel, am 19. Juli 1870 Preußen den Krieg. Durch Verträge gebunden, stellen sich die süddeutschen Staaten, darunter Bayern, sofort an die Seite Preußens, und es kommt zu den ersten Gefechten bei Weißenburg im Elsaß, von denen ein altes bayerisches Soldatenlied erzählt: " . . . Und Weißenburg das war die Stadt, wo es zum ersten Mal gezappelt hat . . . " Namen tauchen auf wie Wörth, Bazeilles, Sedan, der Winterfeldzug an der Loire, der von den bayerischen Soldaten so bittere Opfer fordert, Orleans, von dem es in einem altbayerischen Volkslied heißt: " . . . Zu Orleans wohl an der Kirchhofsmauer, vom Feinde auf drei Seiten rings umgebn, da standen sie die tapferen Streiter und fochten für den König, Land und Lebn." Mancher unserer Feuerwehrmänner mag damals den blitzenden Messinghelm mit dem berühmten schwarz-ledernen bayerischen Raupenhelm vertauscht haben, um mit Gott für König und Vaterland um sein Leben zu marschieren, zu kämpfen, zu schwitzen und zu frieren, sich durch und durch naßregnen und von bratender Augusthitze wieder durchtrocknen zu lassen. Von zweien wissen wir, daß sie verwundet nach Hause gekommen sind und daß sie die Starnberger Feuerwehr besucht und mit Geschenken bedacht hat. Am 18. Januar 1871 wird im Spiegelsaal des Schlosses Versailles bei Paris Wilhelm 1., König von Preußen, zum Deutschen Kaiser ausgerufen. Und damit ist Bayern mit einemmal kein wirklich selbständiges Königreich mehr, wenn ihm auch im Gegensatz zu den anderen Bundesstaaten, wohl mehr der Form halber, einige Reservatrechte bleiben. Der siegreiche Krieg ist zu Ende, die Soldaten kehren, begeistert empfangen, heim, der eine oder andere allerdings wird nie mehr nach Bayern zurückkommen und in Frankreichs Erde bleiben. Die jungen Burschen sind wieder daheim und können im Feuerwehrdienst die alten Männer, die ihn in Kriegszeiten versehen haben, wieder ablösen. Nun wird kein Sedanstag vergehen, der nicht Jahr für Jahr vaterländisch-patriotisch gefeiert wird und bei dem zu Gottesdienst und Kriegerehrung die Feuerwehr, auch in Leutstetten, ausrückt. Von 1874 auf 1875 bekommt die Feuerwehr als eine der ersten im königlichen Bezirksamt Starnberg eine Pumpenmaschine, die die respektable Summe von 1200 Gulden kostet. Sie existiert heute noch und hat bei der 100-Jahrfeier unserer Feuerwehr gezeigt, was sie noch leisten kann. Bis 1938 war sie in Dienst und Einsatz, 27 Jahre ist sie zerlegt auf dem Speicher des Feuerwehrhauses gestanden, ehe sie unsere Feuerwehrmänner heruntergeholt und wieder zusammengesetzt haben. In einer Nacht war die altgediente Pumpe wieder voll einsatzbereit. Sie ist es heute noch, was sie im Lauf der Jahre wiederholt bei Vorführungen bewiesen hat; und man kann nur froh sein, daß sie nicht in die Hände eines Alteisenhändlers geraten ist. 1982 hat man sie allerdings, als sie anläßlich des Festes der Fahnenweihe frisch bemalt worden ist, durch die Aufschrift " 1865 " um zehn Jahre älter gemacht. Ebenfalls im Jahr 1875 tritt der erste Kommandant und Vorstand, Johann Floritz, nach zehnjähriger Tätigkeit zurück. Neuer Kommandant und Vorstand wird Anton Winter, und er wird bis 1907 Vorstand und 35 Jahre lang, bis 1910, Kommandant bleiben.
|